
Jesus wollte, dass wir so beten, dass unsere Gebete erhört werden und Gott mit unseren Gebeten geehrt wird. Die Gebete der Griechen und Römer dienten Jesus dabei als abschreckendes Negativbeispiel. So wie sie sollten wir auf keinen Fall beten. Was Jesus so desaströs an heidnischen Gebeten fand, war dass die Betenden „plappern“ und denken, dass sie aufgrund ihrer vielen Worte erhört werden:
Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. 8 Seid ihnen nun nicht gleich; denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. (Matthäus 6,7-8)
Beim flüchtigen Leser der Aufforderung von Jesus könnte man meinen, Gott will keine langen Gebete. Vielleicht ist er sogar genervt von langen Bittgebeten und will höchstens kurze prägnante Erinnerungen, dass sein Eingreifen gebraucht wird.
Dass es aber im Text wahrscheinlich doch nicht um die Länge von Gebeten geht, erahnen wir, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus selbst die ganze Nacht hindurch gebetet hatte (Matt 14,23-25), dass er seine Jünger aufgefordert hatte, dass sie „immer beten und niemals aufgeben sollen“ und diesen Auftrag auch noch mit dem Gleichnis der standhaften Witwe illustriert hatte (Luk 18,1-7), die als Beispiel dazu diente, dass die Jünger „Tag und Nacht zu Gott rufen sollen“ (Luk 18,7). Auch die Zurechtweisung „könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir beten“ (Matt 26,40-41) kritisiert ja offensichtlich nicht zu viel Gebet, sondern zu wenig.
Wie die Heiden in der Antike gebetet haben.
Was Jesus im Kern an den Gebeten der Heiden kritisiert, lässt sich gut anhand von antiken Darstellungen von Betenden auf Altären illustrieren.
Sowohl formale als auch informale Gebete wurden im Altertum von anderen Ausdrücken der Anbetung begleitet, meistens durch Opfer oder einem Schwur.[1] Gebete an die Götter wurden also vorwiegend vor einem Altar zusammen mit Opfern, Weihgaben und Musik dargebracht, wie zum Beispiel hier um den Altar des Mars und der Venus an der Südwestseite des Theaterportikus in Ostia.

Im häuslichen Umfeld wurden private Gebete zumeist vor den Lararien, also den Kultschreinen der Schutzgötter der Familie im Haus vorgebracht, vor denen sich die Familie unter Leitung des Hausherren versammelte.

Ein eindrückliches Beispiel dafür, was der Hauptpunkt der Kritik von Jesus an heidnischen Gebeten ist, lässt sich an der Darstellung des Weihealtars des Publius Curtius Victor für Jupiter entdecken.

Auf dem Relief sehen wir eine stereotypische Darstellung eines betenden Römers. Ganz rechts sehen wir Publius Curtius Victor in Toga gehüllt. Sein Sohn, Publius Curtius Primus, steht links hinter ihm und hält eine Kiste mit Weihrauch. Der Vater trägt einen Überzug über seinen Kopf, wie es für offizielle Zeremonien vorgeschrieben ist. Mit seiner rechten Hand gießt er eine Flüssigkeit aus der patera (einer zeremoniellen Opferschale) auf die Flamme eines dreifüßigen Altars. In der linken Hand hält er eine Papyrusrolle – auf dieser stehen die zeremoniellen Gebete, die ebenso vorgeschrieben sind! Um genau diese Gebete geht es im Text des Matthäusevangeliums.
Aber betrachten wir uns noch die anderen, ebenso wichtigen Details des Reliefs. In der Mitte spielt ein Musiker eine rituelle Melodie auf einer Zwillingsflöte und ganz links bringt ein Sklave, der entsprechend seines geringen sozialen Standes klein dargestellt ist, einen Ochsen heran, der rituell mit einem dorsuale, einem Opfertuch geschmückt ist. Für unsere Interessen besonders wichtig ist jedoch die eigenartige Person links vom Flötenspieler, der seine rechte Hand an sein Ohr hält, um die Gebete des Publius Curtius Victor besser zu hören. Es handelt sich um einen calator. Im ersten Jahrhundert waren dies überwiegend Freigelassene oder Freie, die den Priestercollegien als Diener beigegeben wurden.[2] Die calatores assistierten den Betenden beim Opfer, hier auf dem Relief hört der calator äußerst aufmerksam dem Betenden zu, denn wenn das Gebet nicht entsprechend der vorgeschriebenen Riten gesprochen wird, müssen Opfer und Gebet wiederholt werden.

Sowohl die Schriftrolle in der Hand des betenden Publius Curtis Victor als auch der calator weisen darauf hin, dass nach heidnischem Verständnis Gebet entsprechend überlieferten Formeln zu erfolgen hat. Der calator wacht darüber, dass unserem Publius während des Gebets keine Fehler unterlaufen. Denn die Gottheit hört nur, wenn sie entsprechend des traditionellen Ritus angesprochen wird und die Gebete in der vorgeschriebenen Weise vorgetragen werden. Selbst eine einzige falsch ausgesprochene Silbe konnte das Gebet ungültig machen.[3] Man musste die Götter mit äußerster Sorgfalt anrufen, um sie nicht zu beleidigen und eben die richtigen Formeln sprechen, um die gewünschte Antwort zu erhalten.[4] Mit dem richtigen Ensemble an Worten, der Ansprache der Gottheiten mit einer Reihe vorgegebener Namen – verbunden mit rituellen Opfern, könnte man Glück haben, die korrekte Kombination getroffen zu haben, welche die Gottheit dazu bringt, zu antworten.
Genau diese Vorstellung, dass man Gott aufgrund von Anrufungen, Besänftigungen oder rituellen Handlungen dazu manipulieren kann, einen Gebetswunsch zu erfüllen, wird von Jesus verurteilt.
Gebete der Heiden aus der Antike
Einige Beispiele für die formelhafte Darbringung der Gebete sowohl im privaten als auch im öffentlichen Kontext sind uns überliefert. So beschreibt zum Beispiel Cato, wie das landwirtschaftliche Frühjahrsopfer des Bauern mit Gebeten vorgebracht werden soll: „Verwende bei der Darbringung [des Opfers an Jupiter Dapalis] diese Formel: „Jupiter Dapalis, weil es sich gehört, dass dir in meinem Haus und inmitten meines Volkes ein Becher Wein für das heilige Fest geopfert wird; und zu diesem Zweck sollst du durch die Darbringung dieser Speise geehrt werden.“ Wasche dir die Hände, nimm dann den Wein und sprich: „Jupiter Dapalis, sei geehrt durch die Darbringung deines Festmahls, und sei geehrt durch den Wein, der vor dir steht…“ Bringe es Jupiter in religiöser Weise und in der passenden Form dar.“[5]
Sehr eindrucksvoll, um griechisch-römische Gebete zu verstehen, sind auch die Inschriften zu den Ludi Saeculares, die uns die typischen formelhaften Gebete an mehrere Gottheiten wiedergeben. Als Illustration zitiere ich eines der Gebete des Kaisers Augustus an die Moires, die römischen Schicksalsgöttinen:
„In der folgenden Nacht hat auf dem Feld am Tiber der Imperator Caesar Augustus den Moiren neun weibliche Schafe geopfert, die vollständig verbrannt wurden, nach griechischem Ritus und auf dieselbe Weise neun weibliche Ziegen, die vollständig verbrannt wurden. Auf folgende Weise hat er gebetet: …Moiren, wie es für euch in jenen Büchern geschrieben steht, und weil es wegen dieser Dinge noch besser für das römische Volk und die Quiriten werde, soll euch von neun weiblichen Schafen und neun weiblichen Ziegen, wie es euch zukommt, ein Opfer dargebracht werden. Euch bitte ich und bete zu euch, dass ihr die Herrschaft und Hoheit des römischen Volkes und der Quiriten in Krieg und Frieden vermehrt, und dass der Latiner immer untertänig sei, dass ihr immerwährenden Sieg und Stärke dem römischen Volk und den Quiriten schenkt und mit Wohlwollen auf das römische Volk, die Quiriten, die Legionen des römischen Volkes und der Quiriten schaut, und den Staat des römischen Volkes und der Quiriten gesund behaltet und größer macht, dass ihr wohlwollend und gnädig seid gegenüber dem römischen Volk und den Quiriten, dem Kollegium der Quindecimviri, mir, meinem Haus und meinen Sklaven gegenüber, dass ihr dieses Opfer von neun weiblichen Schafen annehmt und von neun weiblichen Ziegen, die euch zukommen und zu opfern sind. Deswegen seid geehrt, lasst euch wohlwollend und gnädig stimmen durch dieses weibliche Schaf hier, das geopfert werden muss, gegenüber dem römischen Volk, den Quiriten, dem Kollegium der Quindecimviri, mir, meinem Haus und meinen Sklaven gegenüber.“[6]
Die überlieferten Gebete ergänzen die Betrachtungsweise, welche wir durch die bildliche Darstellung antiker Bitten an die Götter haben: Im Zentrum des Verständnisses, was Gebete sind, steht bei heidnischen Gebetsriten die Idee, dass die Gebete unwillige Götter dazu bewegen, dass sie dem Bittsteller Aufmerksamkeit schenken und die Gebete die Ursache dafür sind, warum die Götter sich dem Bittenden nahen uns seine Wünsche erfüllen.
Was Jesus an den Gebeten der Heiden kritisiert.
Bei der Kritik von Jesus an „vielen Worten des Gebets“ geht es nicht um die Häufigkeit oder die Länge des Gebets, sondern um die Glaubenshaltung, die ihm zugrunde liegt. Es geht um die Frage, ob man auf Gott beschwörend einwirken muss, damit er willig ist, Gebete zu erhören, oder ob Gott aus einem anderen Grund dazu geneigt ist, den Betenden zu umsorgen. Und dieser Grund, warum Gott Gebete hört, ist sein eigener gütiger Charakter, der aus seiner eigenen Barmherzigkeit und Liebe heraus noch vor dem Gebet, den seinen zugeneigt ist.
Dass es sich bei Jesu kritischer Beurteilung von heidnischen Gebeten um Missbilligung des Gedankens der Beschwörung der Götter handelt, wird aus dem Kontrast deutlich, den Jesus den „um ihres vielen Redens willen“ entgegenstellt.
In allen drei Lehren über einen frommen Lebensstil in Matthäus 6 stellt Jesus der getadelten Lebensweise im direkten Kontrast das entsprechende Gegenteil gegenüber. Spenden vor allen den Augen aller Leute, um Ruhm dafür zu erhalten (Matt 6,1-2) wird in Kontrast gestellt zu Geben von Almosen im Verborgenen, die von Gott belohnt werden (Matt 6,3-4). Gebet, um von Menschen gesehen zu werden (Matt 6,5) ist direkt konträr zu Gebet am verborgenen Ort, wo nur Gott sieht (Matt.6,6). Also wird auch aufgrund der rhetorischen Struktur, die Jesus benutzt, auch zwischen „denken, aufgrund vieler Worte gehört zu werden“ und „der Vater weiß, was ihr benötigt“ ein direkter inhaltlicher Kontrast bestehen. Bei der Aussage „euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr in bittet“ geht es nicht rein um die Allwissenheit Gottes. Sie stände nicht im Kontrast zu den Göttern, die zumindest entsprechend heidnischer Mythologie ebenfalls allwissend waren. Schon Homer betitelt die Götter „allwissend“.[7] Das Wissen des Vaters in Matt 6,8 geht über perfektes inhaltliches Wissen hinaus. „Euer Vater weiß, was ihr benötigt“ bedeutet, dass der himmlische Vater um die Nöte weiß und bereit ist, sich um sie zu kümmern. Es ist ähnlich der Antwort auf die Frage meiner Frau, wenn sie sagt „Du weißt, die Kinder haben noch nichts gegessen?“ und ich erwidere „Ja, ich weiß“. Ich meine mit „Ich weiß“ nicht nur, dass ich intellektuell die Fakten zur Kenntnis genommen habe, sondern kommuniziere inhaltlich mit „ich weiß“ auch, dass ich bereit bin und willens bin, der Herausforderung zu begegnen und den Kindern ein vernünftiges Abendessen bereit zu stellen.
Zum himmlischen Vater beten, der nicht manipuliert werden muss, um seine wohlwollende Zuneigung zu erhalten.
Der Kontrast der Einstellungen, die Jesus in Matt 6,7-8 gegenüberstellt sind einerseits der Glaube an unwillige Götter, die man manipulieren muss und kann und andererseits ein kindliches Vertrauen in Gott als wohlwollend fürsorglicher Vater. Ob man kurz oder lang beten sollte, wird von Jesus hier gar nicht thematisiert. Sein wichtigstes Anliegen ist die Frage „Warum denkst du, solltest du erhört werden?“ Die heidnische Antwort wäre „Weil ich die Götter mit aufwendigen Gebeten“ dazu gebracht habe, mich mir zuzuwenden. Die christliche Antwort ist „Ich habe nichts dazu beigetragen, dass Gott mich hört, er tut es aufgrund seines eigenen exzellenten Charakters als fürsorglicher, gnädiger und allwissender Vater.“
Wenn wir nicht wollen, dass unsere Gebete als Geplapper[8] eingeschätzt werden, sollten sie von einem Vertrauen geprägt sein, dass wir uns einem himmlischen Vater zuwenden, dessen grandiosen Wesen unter anderem darin besteht, dass er aus eigener herzlicher und gnädiger Zuwendung, sich um unsere Nöte sorgt.
[1] H.S. Versnel: „Prayer“ in The Oxford Classical Dictionary, 1242-43.
[2] Ernst Samter: „Calatores“ in Paulys Real-Encyclopädie, 5. Halbband, 1335-1336.
[3] John E. Stambaugh und David L. Balch: The New Testament in It’s Social Environment, 129.
[4] R.T. France: The Gospel of Matthew, NICNT, 240-41.
[5] Cato, Agr. 132.1.
[6] Bärbel Schnegg: Die Inschriften zu den Ludi saeculares, 24-27. Zur besseren Lesbarkeit wurden textkritische Zeichen weggelassen.
[7] Die „allwissende Göttin“ in Homer, Iliad, 1.39.26.
[8] Das griechische Wort für „plappern“ (battalogeoo) ist ein onomatopeitisches Wort, also eine Nachahmung von nichtsprachlichen Lauten, die ein Wort formen. Im Deutschen könnte man das zum Beispiel mit „bla-bla-blabbern“ ausdrücken. Die Gebet der Heiden sind nach Jesus also nur „Bla-bla“ – entweder bezieht er sich dabei auf die bedeutungslosen Worte, die bestimmte Tänze und Prozessionen begleiteten und die als Anrufungen des Gottes interpretiert werden konnten, wie ololuge, euphoi, paian (H.S. Versnel: „Prayer“ in The Oxford Classical Dictionary, 1242-43). Wahrscheinlich bezieht sich Jesus aber nicht auf nur ein Element heidnischer Gebete, sondern klassifiziert alle Anrufungen, mit denen die Götter beschwört oder beschwichtigt werden sollen als „leeres Bla-bla.“

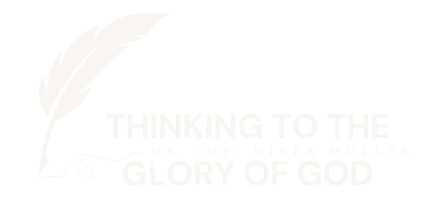
Schreibe einen Kommentar