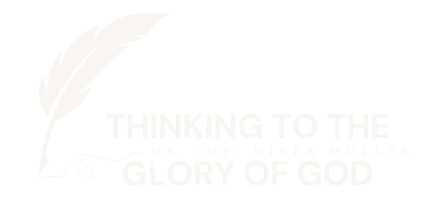Die Ehefrau von Lucius Salvius Secundus hat nicht nur ihrem Ehemann im zweiten Jahrhundert, sondern auch uns einen großen Gefallen getan. Für ihren Ehemann hatte sie eine Ehreninschrift anfertigen lassen, um ihren Mann als hochgestellten Römer, Mitglied des Senats und als legatus pro praetore der Provinz Asiens zu ehren.[1] „Für uns“ hat sie die Inschrift mit der Insignia der Macht, die ihr Mann inne hatte, einen Richterstuhl auf dem Stein anbringen lassen.
Secundus war also einer der mächtigsten Männer des Römischen Reiches – er war vom Kaiser eingesetzter senatorischer Statthalter der prestigeträchtigen römischen Provinz Asien und damit die Nummer eins in dieser römischen Provinz. Seine allumfassende Autorität hat seine Frau durch den Richterstuhl auf der rechten Nebenseite des Ehrensteins anbringen lassen. Auf genau so einem Richterstuhl saß Pontius Pilatus während über das Schicksal von Jesus vor seinem Gericht verhandelt wurde!
Der Richterstuhl ist das herausragende Symbol römischer Macht!
Dieser Richterstuhl, der im griechischen als beema und im lateinischen als sella curulis wiedergegeben wird, ist von großer Wichtigkeit für das Verständnis des Ablaufs der Gerichtsverhandlung um Jesus in den Evangelien. Denn die sella curulis ist das herausragende Symbol der Autorität eines römischen Regenten mit richterlichen Befugnissen. Vom Aufbau war er zwar nur ein Klappstuhl mit x-förmigen gekrümmten Beinen zumeist ohne Rückenlehne, aber nach Jahrhunderterlanger Tradition war er ein enormes Statussymbol und wurde nur für wichtige Amtshandlungen, insbesondere Gerichtsverhandlungen, gebraucht. Die sella curulis stand für den absoluten Machtanspruch Roms und seiner Amtsträger – ohne jeglichen Wiederspruch. Dies wird unter anderem dadurch gut illustriert, dass Abbildungen der sella curulis oft von einer anderen Insignie der macht begleitet wird, den fasces.

Auch der altar-förmige Ehrenstein des Secundus zeigt parallel zur sella curulis eine fasce, also ein Rutenbündel, in welches ein Beil eingeflochten ist und die Macht Roms über Strafe per Auspeitschen oder Hinrichtung zu entscheiden darstellt.
Sowohl Matthäus (Matt 27,19), also auch Johannes (Joh 19,13) schreiben (an unterschiedlichen Stellen während der Gerichtsverhandlung) explizit, dass Pontius Pilatus auf einem beema, also einem sella curulis saß. Sie präsentieren den praefectus Judäas[2] zurecht in seiner allumfassenden richterlichen Macht im Land. Dies ist insofern wichtig, da Pilatus beim kursorischen Lesen als unbeholfener Mann erscheint, der Jesus eigentlich gern freilassen will, aber in dem Netz an Intrigen der jüdischen Führung gefangen ist und vom jüdischen Sanhedrin entgegen seines guten Willens dazu getrieben wird, Jesus zu kreuzigen. Genau dieser falsche Lesart des Textes widerspricht energisch der in den Beschreibungen auftauchende sella curulis. Sie rückt Pilatus wieder ins rechte „Leselicht.“ Das beema erinnert und daran, wen wir in Pilatus eigentlich vor uns haben: den obersten Regenten Judäas, der nur mit dem Finger schnipsen muss und jedermann – inklusive Pharisäer und Sadduzäer – tanzt nach seiner Pfeife!
Wenn Pilatus absolute richterliche Macht hat, warum dauert der Gerichtsprozess so lange?
Aber warum dauert dann der Gerichtsprozess so lange? Allein im Johannesevangelium umfasst er 29 Verse (Joh 18,28 – 19,16). In diesen Versen spricht Pilatus drei Mal (!) das Urteil „Ich finde keinerlei Schuld an ihm“ (Joh 18,38; 19,4,6). Gleich zu Beginn setzt er richterlich fest, dass keine Anklage vorhanden ist, die für sein Gericht relevant ist (Joh 18,31). Zweimal wird der Angeklagte von Pilatus als so lächerlich präsentiert, dass er unmöglich den Anklagen schuldig sein kann (Joh 19,4,14). Und trotz der mehrfachen kontinuierlichen richterlichen Unschuldsbekundungen durch Pilatus geht der Gerichtsprozess weiter und Jesus wird letztendlich per Kreuzigung hingerichtet. Eigentlich hätte ein Mal „Ich finde keinerlei Schuld an ihm“ ausgereicht und Jesus hätte freigelassen werden müssen. Warum ist das Machtwort des Pilatus dann doch kein Machtwort? Warum zieht sich der Prozess weiter in die Länge und endet entgegen dem, was Pilatus immer wieder beteuert: Die Unschuld von Jesus!

Die Idee, dass es an der Hilflosigkeit des Pilatus liegt, der gern anders gewollt hätte, aber nicht konnte, ist nicht plausibel. Die Beschreibung von Pilatus auf der sella curulis malt nämlich ein ganz anderes Bild. Er sitzt auf dem beema wohl wissend, dass er allen Mitspielern im Prozess haushoch überlegen ist. Pilatus symbolisiert mit seinem Sitzen auf der sella curulis, dass die geballten Macht des römischen Reich hinter ihm als richterliche Autorität steht. Wenn Pilatus den Gerichtsprozess trotz seiner mehrmaligen Unschuldsurteile fortführt, dann nicht, weil er nicht anders kann, sondern weil er aus eigenen Motiven nicht anders will. Sein eigener Wille, symbolisiert durch das beema, überragt jedes anderes Entscheidungskriterium.
Pilatus ist sich seiner absoluten Macht sehr bewusst!
Dass Pilatus sich seiner Macht bewusst ist und diese skrupellos nutzt (und missbraucht), davon zeugen die vielen literarischen Berichte, die wir aus der säkularen Geschichtsschreibung haben. In keinem dieser Berichte wird Pilatus als hilfloses Opfer dargestellt, der eigentlich besser handeln will als er kann. Ganz im Gegenteil. Pilatus ist der skrupellose und gewissenlose Tyrann, der sehr wohl weiß, dass er nach Belieben seine Macht demonstrieren kann und seine eigennützigen Interessen über die jüdische Führung hinweg durchsetzen kann. So schreibt zum Beispiel Philo, ein Zeitgenosse von Pilatus über ihn:
(Pilatus), von Natur aus unbeugsam, eine Mischung aus Eigensinn und Unerbittlichkeit, weigerte sich hartnäckig… dann würden auch andere Einzelheiten seiner Regentschaft aufgedeckt werden, indem die Bestechungen, die Beleidigungen, die Räubereien, die Schandtaten und mutwilligen Vergehen, die ständig wiederholten Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, die unaufhörlichen und äußerst schlimmen Grausamkeiten aufgezählt werden… mit seiner Rachsucht und seinem Jähzorn… wollte er nichts tun, was seinen Untertanen gefallen würde.[3]
Auch die Münzprägung während seiner Herrschaft zeigt, dass Pilatus modus operandi ist, maximal provokativ und schikanös zu sein. Um 29 n.Chr. führte Pilatus Prutah ein, also Bronzemünzen zur Bezahlung im Alltag, auf denen ein Simpulum eingraviert war. Ein Simpulum ist ein kultisches Gerät, welches von römischen Priestern in heidnischen Kulten verwendet wurde, um Wein auf die Opferschale zu gießen.

Im Jahr 31 n.Chr. brachte Pilatus eine weitere Serie von Prutah in den Umlauf, nun war ein lituus abgebildet, ein Statussymbol heidnischer religiöser Würde.

Sowohl das simpulum als auch der lituus waren ein direkter Affront gegen die Juden. Gegen ein Volk, welches im ersten Jahrhundert nichts als leidenschaftlichen monotheistischen Glauben an YHWH duldete, wurde von Pilatus gezwungen, die Kleinigkeiten des Alltags mit Münzen zu bezahlen, die kultische Symbole heidnischer Anbetung darstellten. Mit Sicherheit hatte es auch gegen die Münzprägung Einspruch von der jüdischen Führung gegeben, aber Pilatus wusste, wie er seine eigenwilligen Interessen knallhart durchsetzen kann.
Die Entscheidungen im Jesus Prozess, die Pilatus wieder und wieder fiel, waren durchweg von der zugrundeliegenden Absicht des Pilatus geprägt, das Gegenteil von dem zu tun, was die Hohenpriester von ihm verlangten, weil er immer das Gegenteil von dem wollte, was die Hohenpriester von ihm wollten.[4] Wir sehen in den Evangelien einen Pilatus, der entsprechend der außerbiblischen Quellen alles andere als moralische Integrität zeigt. Seine Handlungsweisen sind nicht danach ausgerichtet, was Recht oder Unrecht ist, sondern durch den ganzen Prozess hindurch verfolgt Pilatus seine eigenen starrsinnigen Interessen, die jüdische Führung zu demütigen, lächerlich zu machen und einen Keil zwischen sie und das Volk zu treiben und sich selbst als erhabener Römer darzustellen. Allerdings gelingt keiner seiner taktischen Schachzüge.
Wie Pilatus den Gerichtsprozess um Jesus für seine egomanischen Interessen missbraucht.
Sehen wir uns die einzelnen Entscheidungen des Pilatus während des Prozesses im Johannesevangelium genauer an. Erstens Johannes 18,29-31:
29 Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? 30 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. 31 Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Pilatus fragt entsprechend römischer Regeln des Gerichts die Ankläger, welche Anklage vorgebracht und verhandelt werden soll. Die Antwort der jüdischen Führung ist eine Frechheit ohnegleichen. Es erfolgt nämlich gar keine konkrete Anklage, sondern nur eine allgemeine, vor Gericht völlig unverwertbarer Vorwurf „wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn nicht hergebracht.“ Der Sanhedrin erwartet tatsächlich, dass Pilatus Jesus ohne rechtliche Anklage – nur aufgrund ihren Wünschen – kreuzigt. Den Gefallen tut Pilatus den Juden nicht. Aber anstelle den Gerichtsprozess formal abzuweisen und Jesus frei zu lassen, wittert Pilatus seine Chance, die Juden zu demütigen. Sein „Richtet ihm nach eurem Gesetz“ würde die Juden dazu zwingen, ihren Mangel an Autorität zuzugeben. „Richtet ihm nach eurem Gesetz“ bedeutet, dass die Juden die für römische Interessen uninteressanten Pille-Palle Entscheidungen um die Kleinigkeiten ihres Gesetzes richten dürfen, aber die Dinge, auf die es wirklich ankommt, die großen Gerichtsprozesse, wo Verbannungen und Todesstrafen verhängt wurden, waren Pilatus vorenthalten. Die Antwort des Pilatus zielt darauf ab, dass die Juden ihren geringeren Status gegenüber Pilatus zugeben.
Zweitens Johannes 18,38-39:
38 Und (Pilatus)… ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm; 39 es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passah einen losgebe. Wollt ihr nun, daß ich euch den König der Juden losgebe?
Vom Verlauf der Verhandlung können wir implizieren, dass die Juden inzwischen doch eine konkrete Anklage hervorgebracht haben, nämlich „er ist der König der Juden.“ Die messianischen Ansprüche von Jesus haben sie in eine politische Anklage umgemünzt. Nachdem Pilatus Jesus verhört, spricht er sein Urteil „Ich finde keinerlei Schuld an ihm.“ Auch an dieser Stelle hätte der Gerichtsprozess enden und Jesus freigelassen werden müssen. „Keinerlei Schuld“ ist bereits ein Freispruch vom auf der sella curulis sitzenden Herrscher. Allerdings will Pilatus mehr als eine formale Abwendung des Gerichtsverfahrens. Er wittert eine große Chance, die jüdische Führung vor dem nun versammelten Volk zu blamieren. Das Volk hatte am Abend zuvor bis spät in die Nacht das Passah gefeiert und „ausgeschlafen.“ Jetzt hören jetzt durch Mundpropaganda, dass der berühmte Jesus verhaftet wurde und vor Pilatus vor Gericht steht und eilen zum in der Nähe des Tempels befindlichen Prätorium, um das Schauspiel zu sehen. Es ist in den Augen des Pilatus die perfekte Kulisse, um einen Keil zwischen der jüdischen Führung und dem Volk zu treiben und den Sanhedrin vor der versammelten Masse zu demütigen.
Deshalb beendet Pilatus das Gerichtsverfahren nicht. Stattdessen wendet er das Gerichtsverfahren in eine typische antike Sitte, nämlich die Übergabe der Macht, das Urteil zu sprechen, an die versammelte Zuhörerschaft. Pilatus hat mit Sicherheit gehofft, dass die versammelten Volksmassen nicht hinter dem Sanhedrin stehen, sondern Barmherzigkeit mit ihrem harmlosen „König“ haben. Die Beziehung zwischen dem Volk und der jüdischen Obrigkeit war vielschichtig – es gab jedoch auf alle Fälle genügend Groll im oft verschuldeten Großteil der Bevölkerung gegen die reiche Elite im Sanhedrin. Die beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen barg definitiv Potential.[5] Würde das Volk Jesus wählen, stände der Sanhedrin blamiert und düpiert da und es war sicherlich genau diese Schadenfreude, die Pilatus im Sinn hatte, als er Jesus nicht Kraft seines Gerichtsurteils frei ließ, sondern den Tausch mit Barabbas anbot. Unglücklicherweise für Pilatus ging sein Plan nach hinten los und die jüdische Führung hatte es irgendwie geschafft, das Volk auf ihre Seite zu ziehen und nun um Barabbas, einem leestees, also einem Aufführer, der gemordet hatte,[6] zur Freigabe zu fordern und den unschuldigen Jesus zum Tode zu verurteilen, als wäre er der leestees.
Drittens Johannes 19,1-5:
1 Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um; 3 und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie gaben ihm Schläge [ins Gesicht]. 4 Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wißt, daß ich keinerlei Schuld an ihm finde. 5 Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch!
Nachdem die von Pilatus geplante „Gefangenenfreilassung“ nicht funktioniert hat, versucht er eine neue Taktik, Jesus freizulassen – wieder um die jüdische Führung zu blamieren. Dass Jesus nun ausgepeitscht wird, ist nichts anderes als eine neue Strategie von Pilatus. Die Römer kannten mehrere Auspeitschungen. Erstens die fustigatio, eine weniger strenge Prügelstrafe, die für relativ leichte Vergehen wie Rowdytum verhängt wurde. Zweitens die flagellatio, eine brutale Auspeitschung, die Verbrechern mit schwereren Vergehen verabreicht wurde. Und drittens die verberatio, die schrecklichste aller Geißelungen, die immer mit anderen Strafen, einschließlich der Kreuzigung, verbunden war. Bei dieser letzten Form wurde das Opfer entkleidet und an einen Pfahl gebunden und dann von mehreren Soldaten so lange geschlagen, bis die Soldaten keine Kraft mehr hatten. Das bevorzugte Instrument dazu war eine Peitsche, deren Lederriemen mit Knochen-, Blei- oder anderen Metallstücken versehen waren. Die Schläge waren so brutal, dass die Opfer oft direkt durch die verberatio starben.
Wahrscheinlich wurde Jesus zweimal ausgepeitscht. Die von Johannes berichtete Auspeitschung hier in Joh 19,1 scheint die fustigatio zu sein, die am wenigsten strenge Art. Sie diente dazu, das Opfer zu demütigen.[7] Der Plan von Pilatus war, dass die Juden einen armselig geschundenen Jesus mit einer lächerlichen Dornenkrone und in groteskem Soldatenmantel sehen, um damit einen Eindruck zu dramatisieren, dass Jesus eine armselige und harmlose Figur ist. Sein Anblick sollte Spott hervorrufen, nicht nur über Jesus, sondern auch über die jüdische Führung, die Jesus zu Pilatus gebracht hatte mit der Anklage, er sei ein gefährlicher König. Aber jetzt ist er offensichtlich ein sehr lächerlicher König. Pilatus will wieder einmal wesentlich mehr als die Freilassung von Jesus – er will die jüdische Führung verhöhnen mit einer dramatischen Repräsentation: diese Art von geschlagener Figur ist der gefährliche Mann, den sie vor ihn gebracht haben? Schande über euch![8]
Dabei ist die Freilassung von Jesus nicht das dringendste Anliegen von Pilatus. Denn wiederum spricht der auf der sella curulis sitzende „souveräne Richter“ „ich finde keinerlei Schuld an ihm“ (Joh 19,4). Dieser Ausspruch hätte kraft seines Amtes genügt, um die sofortige Freilassung von Jesus zu bewirken. Aber Pilatus will mehr. Er will and kann nicht davon ablassen, dem Prozess um Jesus für seine eigenen Pläne zu missbrauchen, die jüdische Führung zu verhöhnen. Also wird der ausgepeitschte Jesus mit einem verächtlichen „hier habt ihr euren lächerlichen Typen“[9] präsentiert.
Viertens Johannes 19,6
6 Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
Auch der dritte Versuch von Pilatus, Jesus frei zu lassen und sich gleichzeitig über die jüdische Führung lustig zu machen misslingt. Die Juden übersehen die Beleidigungen über sie und fordern die Kreuzigung von Jesus. Zum dritten Mal spricht Pilatus sein Urteil „Ich finde keine Schuld an ihm.“ Zum wiederholten Mal wäre dies das Machtwort des Pilatus gewesen, welches ausgereicht hätte, um den Prozess mit der Freisetzung des Angeklagten zu beenden. Aber Pilatus kann es nicht lassen, und muss wieder einmal den Versuch einer Demütigung durchsetzen. „Ihr nehmt ihn und kreuzigt ihn“ ist eine Wiederholung der Strategie von Joh 18,30-31. Pilatus bezieht den Juden das zu tun, was beide wissen, unmöglich ist. Die Juden haben nicht die rechtliche Kompetenz die Todesstrafe zu verhängen. Rom behielt sich das ius gladii vor, also das Recht, vom Schwert Gebrauch zu machen. Als Rom Judäa übernahm und im Jahre 6 n. Chr. mit der direkten Herrschaft durch einen Präfekten begann, wurde die Kapitalgerichtsbarkeit den Juden entzogen und dem Statthalter übertragen[10] – Roms übliche Praxis in der Provinzverwaltung. Die Worte von Pilatus sind wieder einmal sarkastischer Spott gegen die Juden. Sie sollen ihre Unfähigkeit in der Angelegenheit zugeben und gedemütigt aus dem Prozess unverrichteter Dinge nach Hause gehen. Allerdings scheitert auch diese Strategie des Pilatus und seine Worte geben anstelle dessen eine Steilvorlage an die Juden für eine geänderte Anklage: „Wenn du über unsere Gesetze sprichst, so haben wir ein Gesetz und nach diesem muss er getötet werden, denn er behauptete der Sohn Gottes zu sein.“
Fünftens Johannes 19,12-16
12 Daraufhin suchte Pilatus ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht; jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. 13 Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl... Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König! 15 Sie aber schrien: Weg, weg! kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 16 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, daß er gekreuzigt würde.
Als Pilatus die revidierte Anklage „Sohn Gottes“ hörte, bekam er Angst.[11] So arrogant viele hohe römische Beamte auch waren, die allermeisten von ihnen waren, wie alle Römer, auch zutiefst abergläubisch. Für ein jüdisches Ohr wäre die Anklage, der Sohn Gottes zu sein, als messianische Anmaßung aufgefasst worden. Für ein griechisch-römisches Ohr klang die Anklage ganz anders. Sie hatte nichts mit Blasphemie zu tun, sondern stellte Jesus in eine nicht näher definierte Kategorie von „göttlichen Menschen“ – begabte Individuen, von denen man annahm, dass sie bestimmte von den Göttern verliehene Kräfte besaßen, die zum Segen oder Fluch wurden, je nachdem wie man solchen Menschen begegnete. Kein Wunder, dass Pilatus einen Anflug von Angst verspürte, er hatte gerade Jesus auspeitschen lassen. Deshalb verhört Jesus Pilatus in Joh 18,6-11 und findet zum wiederholten Mal heraus, dass Jesus absolut unschuldig jeglicher Anschuldigungen ist.
Wir müssen uns also vorstellen, dass, zwischen den Zeilen gelesen, Pilatus ein viertes (!) Mal Jesus als unschuldig vor der Menge präsentiert und seinen Entschluss bekannt macht, den unschuldigen Angeklagten freizulassen.
Es erfolgt jedoch eine dramatische Wendung der Ereignisse. Die Juden nutzen heimtückisch eine Schwäche der Autorität des Pilatus aus, indem sie rufen: „Wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers.“ Pilatus hatte reichlich Grund, die implizite Drohung zu fürchten. Der Kaiser Tiberius war dafür bekannt, dass er schnell einen Verdacht gegen seine Untergebenen hegte, die meist in Verbannung ins Exil oder Mord der Verdächtigen endete. Als Pilatus einige Jahre zuvor die Juden provozierte, indem er Goldschilde mit anstößigen Inschriften am Palast des Herodes anbrachte, drohten die Juden bereits damals, eine Delegation zu Tiberius zu schicken, um sich beim Kaiser zu beschweren. Die Delegation wurde tatsächlich geschickt und die Beschwerden wurden tatsächlich dem Kaiser vorgetragen, worauf der Kaiser vor Wut schäumte und Pilatus einen Drohbrief sandte.[12]
Pilatus hatte also allen Grund, sich vor einer weiteren Beschwerde vor dem Kaiser zu fürchten. Natürlich hätte er sich verteidigen können, indem er die Unschuld des Angeklagten vor dem Kaiser beteuert hätte, aber es war für Pilatus ein nicht vorhersehbares Risiko, wie ein paranoider Kaiser auf zu viele Vorwürfe reagieren würde – und das Schicksal von Jesus war Pilatus eh zweitrangig. Die Vorwürfe, einen Mann begnadigt zu haben, dem Rebellion gegen den Kaiser vom Sanhedrin vorgeworfen wurde, von der obersten Gerichtsbarkeit des Landes (untergeordnet unter die römische Gerichtsbarkeit), wäre beim paranoiden Kaiser nicht gut angekommen. Erstaunlicherweise müssen die Juden in ihrer Drohung „Jeder, der sich zum König macht ist kein Freund des Kaisers“ auf die erste Anklage „Er behauptet ein König zu sein“ zurückgreifen. Die Anklage „Er behauptete der Sohn Gottes zu sein,“ wurde also von den Juden wieder fallen gelassen. Pilatus hätte, wenn er rechtlich integer gewesen wäre, ein leichtes Spiel an dieser Stelle gehabt. Er hatte bereits in Joh 18,38 die Anklage „König der Juden“ als inhaltslos zurückgewiesen. An dieser Stelle hätte er einfach sagen können „Ich höre die Drohung, aber ich habe bereits die Anklage „König“ als nicht substanziell zurückgewiesen, der Angeklagte kommt frei, Ende der Verhandlung“.
Dieses Mal sind es nicht seine persönlichen Rachepläne gegen die jüdische Führung, sondern seine Angst vor persönlichen Konsequenzen, die Pilatus wieder einmal seine sella curulis missbrauchen lassen. Inzwischen weiß Pilatus, dass er der politischen Falle, die ihm gestellt wurde, nicht entkommen kann, aber er verhöhnt seine verhassten Gegner noch einmal. Ohne eine Spur von Reue über die Schande und den Hohn, die er und seine Gegner über Jesus ausschütten, jubelt er Jesus spöttisch zu, wie bei einer Krönung: Hier ist euer König! Pilatus ist nicht dumm. Er weiß genau, dass die angebliche Treue der jüdischen Obrigkeit gegenüber dem Kaiser in Vers 12 nur eine politische Heuchelei ist, die dazu dient, Jesus ans Kreuz zu bringen. Mit dieser Akklamation Jesu wirft er ihnen gleichzeitig mit bitterer Ironie den falschen Vorwurf des Aufruhrs ins Gesicht und verhöhnt ihren Vasallenstatus, indem er sagt, dass dieser blutige und hilflose Gefangene der einzige König ist, den sie jemals haben werden.
Pilatus kennt nur eine Art des Handelns: Provozieren, beleidigen, Macht demonstrieren!
Pilatus handelt im Gerichtsprozess von Jesus genau wie in anderen Begebenheiten seiner Laufbahn. Er provoziert und schikaniert. Recht oder Unrecht sind ihm egal. Ihm geht es hauptsächlich darum, die Juden zu beleidigen und seine maximalen Eigeninteressen durchzusetzen. Nachgegeben wird nur, wenn die Gefahr besteht, dass der Kaiser Wind von seinen dubiosen Herrschaftspraktiken bekommt.[13]
Pilatus wird im Ablauf des Prozesses um Jesus als auf der sella curulis sitzend dargestellt. Pilatus hat allumfassenden richterlichen Macht im Land – und weiss darum. Immer wieder im Gerichtsprozess wird überdeutlich, dass Jesus unschuldig ist. Aber Pilatus nutzt seine richterliche Macht nicht, um das offensichtlich notwendige Urteil zu fällen, sondern missbraucht seine gewaltige Autorität für eigene Interessen. In gewisser Weise ist Jesus zwei Mal unter die Räder korrupter Macht gekommen. Das erste Mal durch seine Verurteilung vom Sanhedrin aufgrund des Neides der Juden (Joh 11,47-53; Mar 15,10). Und das zweite Mal durch einen korrupten Egomanen Pilatus.
Wer denkt, dass er den Gerichtsprozess leitet und wer es wirklich tut.
Eine wichtige Begebenheit dürfen wir jedoch nicht übersehen. Pilatus hat sicher erwartet, auch an diesem schicksalhaften Tag in typisch triumphierender Pose aus seinem Richterstuhl zu sitzen und seine Erhabenheit als römischer Präfekt zu demonstrieren.

Dadurch, dass die Juden aber aufgrund des bevorstehenden Festes der ungesäuerten Brote[14] nicht in das Prätorium des Pilatus hineingehen wollen, damit sie sich nicht rituell verunreinigen, war Pilatus gezwungen, zur Anhörung der Anklage (sicherlich inklusive sella curulis) nach draußen zu gehen. Pilatus wird sich nicht viel dabei gedacht haben. Einmal kurz mit dem Richterstuhl nach draußen, um die Anklage zu hören, vielleicht noch einmal rein, um die Verteidigung des Angeklagten zu hören und dann wieder raus mit dem beema, um das Urteil zu sprechen. Aber durch sein eigenes Hinauszögern des Prozesses aufgrund seiner Machtspiele mit den Juden wird aus der Machtpose auf der sella curulis nichts. Ständig muss Pilatus raus aus dem Prätorium zu den Juden, hinein ins Prätorium zu Jesus, heraus zu den Juden, hinein zum Angeklagten, wieder heraus und wieder hinein. Und das ganze noch einmal. Im Laufe der Geschichte wirkt Pilatus eher wie ein gehetzter Bote als wie ein souveräner Richter. Pilatus hat den Prozess von Anfang bis zum Ende nicht unter seiner Kontrolle.
Der aufmerksame Leser erkennt dabei, dass beim Gerichtsprozess um Jesus jemand ganz anders die Fäden souverän in der Hand hat. Pilatus denkt, dass in ihm sich allumfassende Macht konzentriert (Joh 19,10). Die Juden denken, dass sie Pilatus dahin manipulieren können, ihren Willen zu tun. Aber im Verborgenen lenkt jemand ganz anders jedes Detail des Gerichtsprozesses sprichwörtlich souverän. Es ist ultimativ der himmlische Vater, der in seiner weisen Vorsehung jeden kleinsten Bruchteil der Gerichtsverhandlung seines Sohnes so führt, dass exakt Sein souveräner Wille geschieht. So dass schon während des Gerichtsprozesses Johannes schreiben kann: „Damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte“ (Joh 18,32). Und so verkündigten die Apostel später: „Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht.“
„Wer hat Jesus dem Tod übergeben? Nicht Judas aus Geldgier, nicht Pilatus aus Angst, nicht die Juden aus Neid, sondern der Vater aus Liebe“.[15]
[1] Die Übersetzung der Inschrift lautet: „Für Lucius Salvius Secundinus, den Sohn des Secundus, aus der tribus Quirina, den questor urbanus, unter die Aedilicier aufgenommen vom Imperator Antonius Augustus, praetor urbanus, legatus pro praetore der Provinz Asien, hat Petrusia Augurina, seine Frau, die Inschrift anfertigen lassen.“ Siehe Peter Pilhofer: Philippi Band II. Katalog der Inschriften von Philippi, 462-463, Nummer 386a.
[2] So entsprechend der 1962 veröffentlichten Inschrift, die im herodianischen Theater von Caesarea gefunden wurde. Tacitus, Annalen, 15.44.4. beschreibt Pilatus als procurator, ein Titel, der erst seit Claudius (41-54 n.Chr.) verwendet wurde.
[3] Philo, Legatio ad Gaium, 301-03.
[4] N.T. Wright: Jesus and the Victory of God, 543-47.
[5] Josephus, Bellum Judaicum, 2.17.425-29.
[6] Siehe Mar 15,7 und Josephus, Bellum Judaicum, 2.13.250-60.
[7] D.A. Carson: The Gospel According to John, PNTC, 596-98.
[8] J. Ramsey Michaels: The Gospel of John, NICNT, 929-32.
[9] „Siehe der Mensch“ (gr. idou ho anthroopos) deutet nicht auf die besondere Menschlichkeit von Jesus hin, sondern ist verächtlich beleidigend (LSJ XXX, Gemoll, 74, cf. Joh 6,53; 7,15,27,35; 9,29; 18,30,40).
[10] Josephus, Bellum Judaicum, 2.117.
[11] Das „noch mehr“ in „fürchtete sich noch mehr“ (gr. mallon) aus Joh 19,8 bedeutet nicht, dass Pilatus sich die ganze Zeit fürchtete, nun jedoch noch mehr, sondern führt eine Alternative ein „anstelle seiner bisherigen Einstellung“. Siehe J. Ramsey Michaels: The Gospel of John, NICNT, 933. Jetzt, das erste Mal, fürchtet Pilatus sich.
[12] Philo, Legatio ad Gaium, 302.
[13] Josephus, Antiquitates Iudaicae, 18.3.1-2.; Philo, Legatio ad Gaium, 299-305.
[14] Die Bemerkung von Johannes „damit sie das Passahfest essen können“ bezieht sich auf das Fest der ungesäuerten Brote. Das Passahmahl hat bereits am Abend zuvor stattgefunden, wo unter anderem Jesus mit seinen Jüngern das Passahmahl gegessen hat (vgl. Lukas 22, 15 „Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich leide.“ Das „Passahfest essen“ in Joh. 18, 28 bezieht sich nicht auf das eigentliche Passahmahl, sondern auf das Fest der ungesäuerten Brote, das sieben Tage andauerte und direkt anschließend an das Passahmahl gefeiert wurde. Insbesondere kann die Aufmerksamkeit auf das Festopfer gerichtet werden, das am Morgen des ersten vollen Festes der ungesäuerten Brote dargebracht wurde (siehe 4. Mose 28, 16-19 „Und im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats, ist Passah für den HERRN. 17 Und am fünfzehnten Tag dieses Monats ist ein Fest; sieben Tage sollen ungesäuerte Brote gegessen werden. 18 Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein; keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. 19 Und ihr sollt ein Feueropfer darbringen, ein Brandopfer für den HERRN: zwei Jungstiere und einen Widder und sieben einjährige Lämmer; ohne Fehler sollen sie euch sein“). Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass sich „das Passahfest“ auf das kombinierte Fest des Passahfests selbst und des anschließenden Festes der ungesäuerten Brote bezieht (z. B. Luk 22, 1: „Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passahfest genannt wird“).
[15] John Stott: The Cross of Christ, 64.