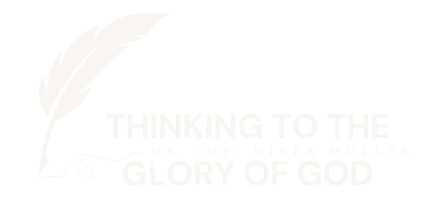In Apg 18,18 finden wir eine der rätselhaftesten Begebenheiten der Apostelgeschichte: Paulus lässt sich die Haare schneiden, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Viel Papier wurde mit Spekulationen darüber beschrieben, welche Art von Gelöbnis sich Paulus unterworfen hatte und warum Lukas es aufschreibt, anscheinend ohne auf die Bedeutung des Schwurs von Paulus einzugehen.[1] Die Frage bleibt bestehen: Warum erwähnt Lukas den Eid des Paulus und warum legte Paulus überhaupt ein Gelübde ab und beendete es in Kenchräe?
Die Mutmaßungen moderner Theologen liefern keine befriedigende Erklärung dafür, warum Paulus einen Schwur abgelegt hatte und diesen mit dem Schneiden seiner Haare in Kenchräe beendete. Die Theorie, dass Paulus sich als „gesetzestreuer Jude“ zeigen will[2] beziehungsweise sich mit den Juden-Christen in Jerusalem gut stellen will[3] scheitert daran, dass es in Kenchräe niemanden gibt, der sich für einen „gesetzestreuen Paulus“ interessiert. Einige Monate vorher hatte Paulus in Korinth in einer Symbolhandlung den Zorn Gottes über die Juden der dortigen Synagoge deklariert und sich damit endgültig von ihnen abgewandt (1 Kor 18,6). Ein jüdischer Schwur der Hingabe an Gott hätte diese drastische Begebenheit nicht wieder wett gemacht. Hatte es auch offensichtlich nicht, denn Paulus begann sein Gelübde in Korinth und trotzdem nutzten die korinthischen Juden die erste Chance, die sich ihnen bot, um Paulus zu verfolgen, indem sie Paulus beim Amtsantritt des neuen Prokonsuls verklagten (Apg 18,12-17).
Außerdem, wenn Paulus hätte zeigen wollen, dass er ein gesetzestreuer Jude ist, hätte er sein Haar nicht in Kenchräe abgeschnitten, sondern in Jerusalem, wie es die strikte Auslegung der Anforderung an ein Nasiräer-Gelübde erfordert (4 Mose 6,1-21). In Jerusalem interessiert man sich dafür, ob Paulus das mosaische Gesetz hochhält (siehe Apg 21,17-26), aber nicht in Kenchräe oder Korinth.
Die allermeisten Bibelausleger konzentrieren sich darauf zu klären, ob der Schwur von Paulus ein echtes Nasiräer-Gelübde oder eine abgewandelte Form eines privaten Gelöbnisses war. Die Frage, warum Paulus das Gelübde abgelegt hatte und warum es Lukas so wichtig war, es in seinem Buch zu erwähnen, bleibt unbeantwortet oder man behauptet „der Grund für das Gelübde ist undurchsichtig.“[4]
Die Erwähnung des Gelübdes von Paulus ist für Lukas nicht nebensächlich, sondern von strategischer Bedeutung
Allerdings ist zurecht anzunehmen, dass Lukas sein Papier nicht für unnütze Informationen verschwendet, die von seiner strategischen Kommunikation der Hauptaussage seines Werkes nur ablenken. Es muss einen wichtigen Grund gegeben haben, warum Lukas das Gelübde von Paulus erwähnt, und warum er es genau an dieser Stelle der Apostelgeschichte nennt.
Das Wissen über die archäologische Situation von Kenchräe ist das wichtigste Indiz für die Antwort auf die Frage, warum Lukas das Gelöbnis des Paulus beschreibt. „Lage, Lage, Lage“ ist der Slogan der Immobilienhändler, um auf die Wichtigkeit des Ortes hinzuweisen, wo die Immobilie sich befindet. Lage, Lage, Lage wird entscheidend sein, um Apostelgeschichte 18,18 zu verstehen. Nur wer weiß, wo er sich befindet, wenn von Kenchräe die Rede ist, wird die Gedanken des Lukas nachvollziehen können.

Korinth ist ein enorm wichtiger Verkehrsknotenpunkt auf der Ost-West-Verbindung Griechenlands. Insbesondere die Schifffahrt kommt auf dem Weg von Ost nach West nicht an Korinth vorbei. Die Umschiffung der Halbinsel Peloponnes im Süden war ein riesiger Umweg und aufgrund seiner seefahrerischen Tücken unbeliebt. Die meisten Schiffe fuhren deshalb den Isthmus von Korinth an, wo die blühende wirtschaftliche Metropole Korinth zwei Häfen hatte: Lechaion im Westen war das Tor zum Golf von Korinth und Kenchräe im Osten war Ankunfts- und Abfahrtsort der Schiffe in den Saronischen Golf.

Ladung und/ oder Schiffe wurden dann mit Transportvorrichtungen auf dem Diolkos über den Landweg an die andere Seite des Meeres gezogen, um von dort aus weiter zu segeln.

Der damalige Leser, wenn er von Kenchräe in Apg 18 liest, verknüpft damit automatisch, dass dies der Hafen von Korinth ist! Wer von Kenchräe absegelt, verlässt gerade Korinth! Es ist eine folgenschwere Fehleinschätzung, Kenchräe als „Zwischenstop“ einer Reiseroute anzusehen.[5] Die in Apostelgeschichte 18,18-22 aufgeführte Reiseroute ist nicht Korinth – Kenchräe – Ephesus – Caesarea – Jerusalem, sondern Korinth (Abreise vom Korinther Hafen Kenchräe) – Ephesus – Ceasarea – Jerusalem. Kein Mensch würde heute, wenn er in den Urlaub fliegt, den Abflugsort „Flughafen“ als Zwischenstop beschreiben. Ebensowenig ist Kenchräe ein Zwischenstop des Paulus. Es ist für das Verständnis der Begebenheiten, die in Kenchräe passiert sind, von enormer Wichtigkeit zu beachten, dass Kenchräe keinen separaten Aufenthaltsort von Paulus auf einer Missionsroute darstellt, der unabhängig von Korinth ist. Ein Abschied vom Hafen von Kenchräe ist ein Abschied von Korinth! Literarisch ist das Haareschneiden in Kenchräe mit Korinth verbunden. Es muss etwas in Korinth passiert sein, das mit dem Schwur des Paulus zu tun hat.

Was passierte in Korinth, was den Beginn des Gelübdes von Paulus veranlasste?
Als Paulus nach Korinth kommt, ist in den ersten Wochen seines Aufenthalts der Umfang der Verkündigung des Evangeliums noch eingeschränkt. Paulus verbringt viel Zeit damit, sich seinen Lebensunterhalt durch Arbeit in der Werkstatt von Aquila und Priscilla zu verdienen (Apg 18,3). Als finanzielle Hilfe aus Mazedonien durch Silas und Timotheus Paulus erreicht, widmet er sich ausgiebig der Verbreitung der guten Botschaft (Apg 18,4-5). Das Resultat der Intensivierung der Evangelisationsbemühungen ist jedoch nicht Erfolg, sondern erheblicher Widerstand. Die Juden „widerstreben“ Paulus und „lästern“. Das griechische Wort für „widerstreben“, antitassomai, erscheint nur hier in der Apostelgeschichte und suggeriert „organisierten Widerstand.“[6] Lästern, griechisch blaspheoo, beschreibt eine intensive verbale Beleidigung. Die Reaktion des Paulus, eine Symbolhandlung, durch die er sich von den Juden in Korinth abwendet und sie dem Gericht Gottes überlässt, lässt den Rückschluss zu, dass die Verfolgung so intensiv war, dass keine weitere Interaktion mit den Juden Korinths mehr möglich war.
Im Kontrast dazu steht die Erscheinung des Herrn in Apg 18,9-10, welcher Paulus in einer Vision in der Nacht auffordert, sich nicht zu fürchten, weiter zu reden und nicht aufzuhören, das Evangelium zu verbreiten. Die Zeitformen der Verben könnten darauf hindeuten, dass sich Paulus sehr gefürchtet und beinahe aufgehört hatte, das Evangelium zu verkündigen.[7] Der Herr, der in der Vision erscheint, ist der Herr Jesus! Die Vision greift also das große Thema von Lukas auf, dass der auferstandene Sohn Gottes, der zur Rechten des Vaters sitzt, die Mission der Ausbreitung des Evangeliums anführt.[8] Im enormen Gegensatz zu den Verhältnissen vor Ort – Antagonismus, organisierter Widerstand, geschlossene Türen, das Evangelium unter den Juden weiter zu verkündigen -, erscheint jetzt der souverän herrschende Christus und fordert Paulus auf, das Evangelium weiter zu verkündigen. Als Grund dafür nennt Christus drei Dinge:
Erstens die Formel „Ich bin mit dir“, welche an die alttestamentlichen Versprechen YHWHs erinnert (1 Mose 26,24 „Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht! Denn ich bin mit dir…“; 1 Mose 28,15; Jes 41,10 „fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.“), insbesondere an die Anweisungen an Jeremia ein mutiger Prophet YHWHs zu sein „Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der HERR, um dich zu erretten.“ (Jer 1,19; cf. Jer 1,8).
Zweitens die Verheißung, dass es zwar Angriffe auf Paulus geben wird, diese ihm aber nicht schaden werden: „niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun“ (Apg 18,10).
Und drittens verheißt der auferstandene Christus, dass es beträchtliche Bekehrungen in Korinth geben wird – mit den Worten „ich habe ein großes Volk in dieser Stadt“. Wir finden in Apg 18,10 für den Begriff „Volk“ das griechische Wort laos, das Wort, welches im Alten Testament verwendet wurde, um das Gottesvolk im Kontrast zu den heidnischen Völkern zu beschreiben.[9] Es wird jetzt hier benutzt, um das neue auserwählte Volk zu beschreiben, welches Juden und Heiden beinhaltet,[10] und um gleichzeitig das Thema aus Apostelgeschichte 15,14 weiterzuführen „Gott hat… darauf gesehen, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.“[11] „Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt“ ist Souveränitäts-Sprache, dass Christus viele Menschen in Korinth auserwählt hat, zu seinem Volk zu gehören und dass sie aufgrund der Kombination der Predigt des Evangeliums durch Paulus und durch das souveräne Herzen öffnende Wirken des Christus (Apg 16,14) zum Glauben kommen werden. Diese Begegnung mit dem erhöhten Christus, der inmitten einer aussichtslosen Situation Paulus Schutz und Erfolg verspricht, muss eine lebensverändernde Begegnung für Paulus gewesen sein. In Folge dessen entschließt er sich, insgesamt achtzehn Monate (die bisher längste Zeit in einer Stadt auf einer seiner Missionsreisen) in Korinth zu bleiben.
Das Gelübde des Paulus war verbunden mit dem wichtigsten Ereignis in Korinth
Das Gelübde des Paulus, welches er mit seinem Haarescheren in Kenchräe, also beim Weggang von Korinth beendet, muss seinen Anfang in Korinth gehabt haben.[12] Da Lukas es nicht weiter erklärt, ist davon auszugehen, dass er erwartet hat, dass der Leser von sich aus die Gedankengänge verknüpft. Es wird vom Leser erwartet, dass das Haareschneiden mit dem wichtigsten von Lukas geschilderten Ereignis in Korinth verbunden wird. Haarescheren geschieht am Ende eines Nasiräischen Schwures, also in dem Moment, wo die Zeit der besonderen Hingabe an Gott beendet wird. Das Gelübde des Paulus ist entweder ein vollumfänglicher Nasiräischer Schwur oder ein Schwur an den Gott Israels, der dem Vorbild des Nasiräischen Gelübdes nachpfunden ist.[13]
Das Nasiräische Gelübde beinhaltete in seiner ursprünglichen Bedeutung, die es nie verloren hatte, die Idee, dass der Geber des Gelübdes für eine Zeit lang ein besonderes Gott geweihtes Leben führt.[14] Es ist von der literarischen Anordnung der Apostelgeschichte durch Lukas offensichtlich, dass Paulus das Gelübde als Resultat seiner Begegnung mit Christus aufgenommen hatte.
Man muss sich vorstellen, dass Paulus – ähnlich wie Jakob in 1 Mose 28 – auf die Erscheinung von Christus in der Nacht reagiert hat, indem er geantwortet hat „da du mir versprochen hast, mit mir in Korinth zu sein und mich zu beschützen und meiner Mission Erfolg geben wirst, weihe ich dir meine Zeit in Korinth vollumfänglich, werde mutig predigen und als Zeichen meiner Hingabe… meine Haare nicht schneiden.
Die Apostelgeschichte berichtet als Nächstes in Apg 18,12-17 von genau diesem Schutz, den Christus in der Vision versprochen hatte. Die Verfolgung der Juden intensiviert sich noch einmal. Mit Amtsantritt von Gallio als Prokonsol von Achaia im Frühjahr 51 n. Chr. wird Paulus vor das beema, das öffentliche Gericht des Gallio, gebracht. Zum ersten Mal in der Apostelgeschichte ist in der Verfolgung der Apostel ein derart hochrangiger römischer Beamter in Form eines Konsuls beteiligt. Bisher waren es nur lokale Behörden, welche Teil der Verfolgung waren, nun ist es das erste Mal die römische Staatsmacht, die eingeschaltet wird. Die Verheißung des Christus (der die Herzen der Regenten in seiner Hand hat) wird jedoch wahr und Gallio entscheidet sich der Anklage der Juden nicht statt zu geben. Stattdessen wird der jüdische Vertreter der Synagoge, der die Anklage wahrscheinlich vorgebracht hat, von den Liktoren des Gallio vor dem Richterstuhl ausgepeitscht.
Apostelgeschichte 18,18, der Abschied von Kenchräe, welcher der Abschied von Korinth ist, ist ein Vers der erfolgreichen Zusammenfassung der Korinth-Mission. Lukas beschreibt explizit, dass sich Paulus seine Haare in Kenchräe schneiden lassen hat und damit in Kenchräe sein Gelübde zu Ende bringt: „Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchräe das Haupt hatte scheren lasen, denn er hatte ein Gelübde.“
Paulus beendet sein Gelübde an seinem letzten Tag in Korinth, weil seine Hingabe an Gott als Reaktion auf die Verheißung des Christus „ich werde dich in Korinth beschützen und in Korinth Erfolg geben“ beendet war.
Nicht nur die Bemerkung, dass es in Kenchräe – der Hafenstadt von Korinth – war, dass Paulus sein Gelübde beendet hatte und damit auf die Vision des Christus zurückgreift ist wichtig, sondern drei weitere Worte im Text, die wir viel zu leicht überlesen: tois adelphois apotaxemenos „er nahm Abschied von den Brüdern“! Von welchen Brüdern? Den Brüdern in Korinth! Den Brüdern, die es zur Zeit von Apostelgeschichte 18,10 nur in der souveränen Vorhersehung Gottes gegeben hatte, und die jetzt am Kai von Kenchräe als weiteres Zeichen dafür stehen, dass Jesus der auferstandene Herr zur Rechten Gottes ist.

Ihre Existenz wurde von Christus in einer Vision mehrere Monate zuvor vorhergesagt. Sie waren achtzehn Monate vorher nicht für möglich gehalten worden. Achtzehn Monate zuvor sah es so aus, als wenn Korinth als Missionsstation aufgrund der intensiven Verfolgung scheitern würde. Aber Christus erschien und sagte: „Ich habe ein großes Gottesvolk in dieser Stadt.“ Nun stehen diese Brüder, das neue Gottesvolk, welches Christus gehört, an der Hafenmole und sehen zu, wie Paulus sein Gelübde mit dem Schneiden seiner Haare beendet. Es wird für sie ein unvergesslicher Moment gewesen sein. Sie stehen am Hafen von Kenchräe aufgrund seines Gelübdes! Sie sind „Brüder“, weil Paulus nach der Vision in der Nacht sein Leben Christus besonders geweiht hatte. Sie sind Christen, nur weil Christus selbst als der auferstandene Herr in Korinth eingegriffen hatte, Paulus ermutigt hatte und ihr Herz beim Hören des Evangeliums aufgetan hatte. Sie sind der lebendige, nun auf dem Marmor des Hafens stehende Beweis, dass Christus tatsächlich der versprochene und erhöhte Retter ist, der zur Rechten Gottes sein Reich baut.
Das Schneiden der Haare und die Hauptbotschaft der Apostelgeschichte
Die Beschreibung des Lukas, dass Paulus sein Gelübde mit dem Scheren der Haare in Kenchräe beendete, ist kein nebensächlicher und zu vernachlässigender Vermerk von ihm. „Die neue Frisur zu Kenchräe“ ist rhetorische Raffinesse, die Hauptbotschaft der Apostelgeschichte auch in kleinen Details zu kommunizieren. Lukas geht es primär darum aufzuzeigen, dass die Dinge, die in der Apostelgeschichte passieren, nicht die „Taten der Apostel“ sind, sondern nur als „Taten des auferstandenen Christus“ beschrieben werden können. Was sich vor unseren Augen in der Apostelgeschichte abspielt, ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen in Christus. Wer dabei war oder jetzt liest, was passiert ist, kann nur zu dem Schluss kommen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass er dafür verantwortlich ist, wie sich die Geschichte in der Apostelgeschichte entwickelt.[15]
Derjenige, auf den das Gesetz hingewiesen hat, ist gekommen, er ist auferstanden und regiert. Auch in Apostelgeschichte 18 haben wir ein Vorkommnis, welches wiederholt aufzeigt, dass die Apostel und Gläubigen nicht im Widerspruch zum Gesetz stehen, sondern das Gesetz in Christus erfüllt ist.[16] Das Nasiräische Gelübde, ein Gelübde der besonderen Hingabe an YHWH, wird von Paulus als eine Hingabe an Christus gelebt.
Paulus hätte mit dem Scheren seiner Haare nur noch einige wenige Wochen warten können. Dann hätte er sich die Haare in Jerusalem scheren können. Damit wären die genauen Bestimmungen des Abschlusses des Nasiräatsgelübde gemäß 4 Mose 6 mit den damit verbundenen Opferdarbringungen in Jerusalem erfüllt gewesen.[17] Paulus hätte damit auch den Theologen des 21. Jahrhunderts viel Kopfzerbrechen erspart, die bis dato erfolglos damit ringen, ob das Gelübde des Paulus ein echtes Nasiräatsgelübde war oder nicht. Aber Paulus (wie Lukas nach ihm) wollte mit seinem Gelübde auch Theologie vermitteln. Er wollte das Gelübde an Christus knüpfen, welcher die Erfüllung des mosaischen Gesetzes ist. Die Haare mussten in Kenchräe geschnitten werden, denn mit seinem Schritt auf die Planke des Seglers war die Zeit der besonderen Hingabe an Christus, die der Verheißung von Christus in Korinth „ich werde mit dir sein, keiner wird dir schaden, ich habe ein großes Volk in der Stadt“, beendet.
In gewisser Weise hat Paulus in Korinth zwei Zeichenhandlungen durchgeführt. Zum einen schüttet er seine Kleider in der Synagoge aus (Apg 18,6), um aufzuzeigen, dass er unschuldig am Gericht ist, welches die ungläubigen Juden in Korinth heimsuchen wird. Und achtzehn Monate später fällt sein Haar auf den Boden im Hafen von Kenchräe in Erinnerung daran, dass die Männer und Frauen, die sich am Hafen verabschieden, nur deshalb Christen geworden sind, weil der lebendige und regierende Christus mit Paulus „nach Korinth gekommen war“ und ihre Bekehrung das Werk des Auferstandenen war. Christus war seinen Verheißungen treu und hatte durch das Predigen des Paulus ein großes Volk in Korinth zu sich gerufen.
[1] Der Eid des Paulus wurde so missverstanden, dass die wichtigsten Manuskripte der lateinischen Vulgata sogar beschreiben, dass nicht Paulus sich die Haare schneiden lassen hat, sondern Aquila. Die Vulgata, also die lateinische Übersetzung der griechischen Bibel, die ab Ende des 4. Jahrhunderts entstand, tat dies offensichtlich mit der Absicht, Paulus davon freizusprechen, was als Kompromiss mit gesetzlichen Ritualen angesehen wurde. Obwohl der originale griechische Text Apollo als denjenigen, der sich die Haare schneiden ließ, grammatikalisch zulässt, ist dies vom Kontext her extrem unwahrscheinlich. Die natürliche Betonung des Kontextes weist auf Paulus hin. Für ihn interessiert sich Lukas in diesem Abschnitt, nicht für Apollo.
[2] Keener, Greg: Acts, Vol. 3:2783-2787; Garland, David: Acts, 192.
[3] Stott, John: The Message of Acts, 301.
[4] Peterson, David: The Acts of the Apostles, PNTC, 519.
[5] „When Paul leaves Corinth, he stops at Cenchrae.“ in: Schreiner, Patrick: Acts, CSC, 505.
[6] Bock, Darell: Acts, BECNT, 579.
[7] Kellum, Scott: Acts, EGGNT, 209.
[8] ebd.
[9] Stott, John: The Message of Acts, TBST, 298.
[10] Bruce, F.F.: The Acts of the Apostels, 394.
[11] Peterson, David: The Acts of the Apostles, PNTC, 514.
[12] Einige Kommentatoren sehen es als „möglich“ an, dass das Gelübde im Zusammenhang mit der Vision von Christus oder der Anklage vor Gallio war und im Zuge der Dankbarkeit oder Bitte im Schutz das Gelöbnis gegeben wurde, führen aber den Gedanken leider nicht weiter. Barrett, C.K.: The Acts of the Apostles, CEC, 877; Bruce, F.F.: The Book of Acts, NICNT, 355; Stott, John: Acts, BST, 301; Bock, Darell: Acts, BECNT, 585; Peterson, David: The Acts of the Apostles, PNTC, 519.
[13] Keener, Greg: Acts, Vol. 3: 2781. Die Schwierigkeit, das Gelübde klar zu definieren, liegt darin begründet, dass das nasiräische Gelübde zwar im Ausland aufgenommen, aber nur in Jerusalem beendet werden konnte. Es gibt außer hier in der Apostelgeschichte keinen literarischen Hinweis darauf, dass ein nasiräisches Gelübde außerhalb von Jerusalem abgeschlossen wurde. Allerdings gibt es auch keinen literarischen Hinweis darauf, dass im Judentum private Gelübde abgelegt wurden, welche das Schneiden der Haare am Ende des Gelübdes beinhalteten. Sowohl die Tatsache, dass das Scheren der Haare stattfand als auch, dass Lukas in Apg 18,18 dasselbe griechische Wort euchee für Gelübde, wie in Apg 21,23 verwendet – letzteres eindeutig ein Nasiräisches Gelübde, scheinen darauf zu deuten, dass ein echtes Nasiräisches Gelübde in Apg 18,18 gemeint war. Vielleicht gab es die Möglichkeit der ordentlichen Beendigung des Nasiräischen Gelübdes in der Diaspora, ohne dass wir heute literarische Indizien dafür vorweisen können.
[14] Strack, Hermann und Billerbeck, Paul: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte erläutert aus Talmud und Midrasch, 747.
[15] Vgl. Thompson, Alan: The Acts of the Risen Lord Jesus.
[16] ebd., 177-91.
[17] Für die Bedingungen um das Nasiräatsgelübde siehe Strack, Hermann und Billerbeck, Paul: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte erläutert aus Talmud und Midrasch, 749.